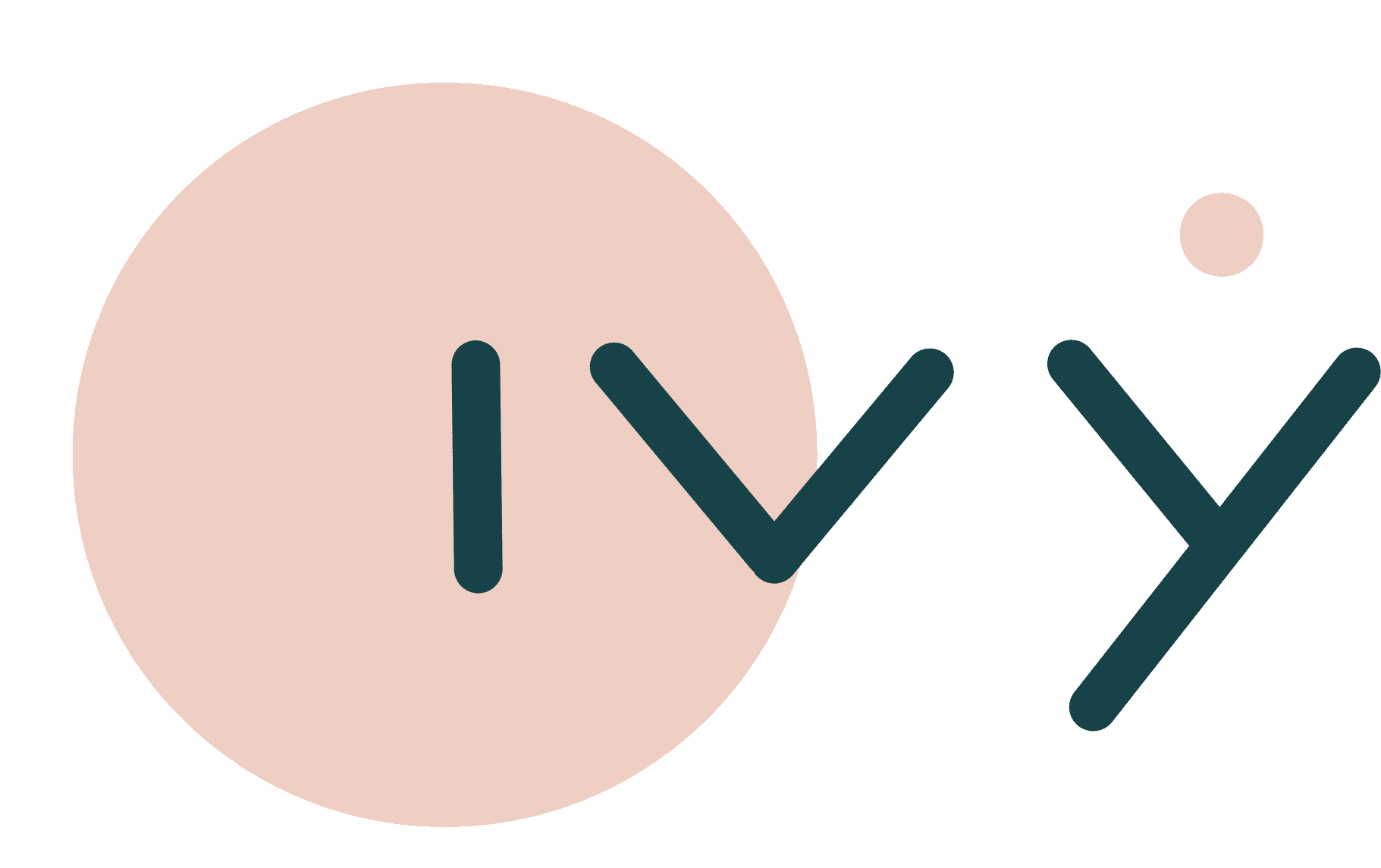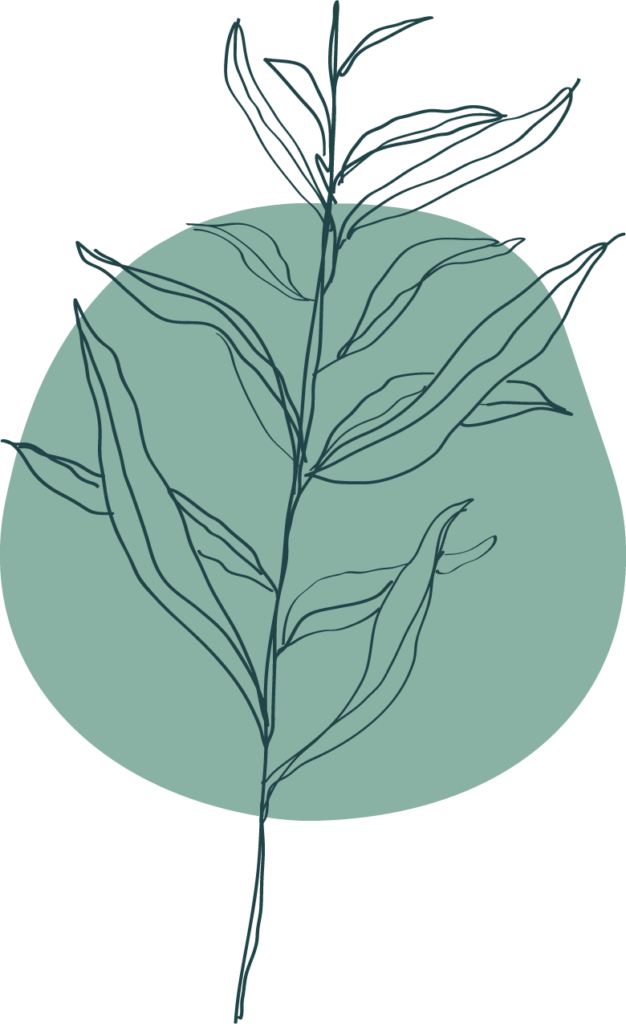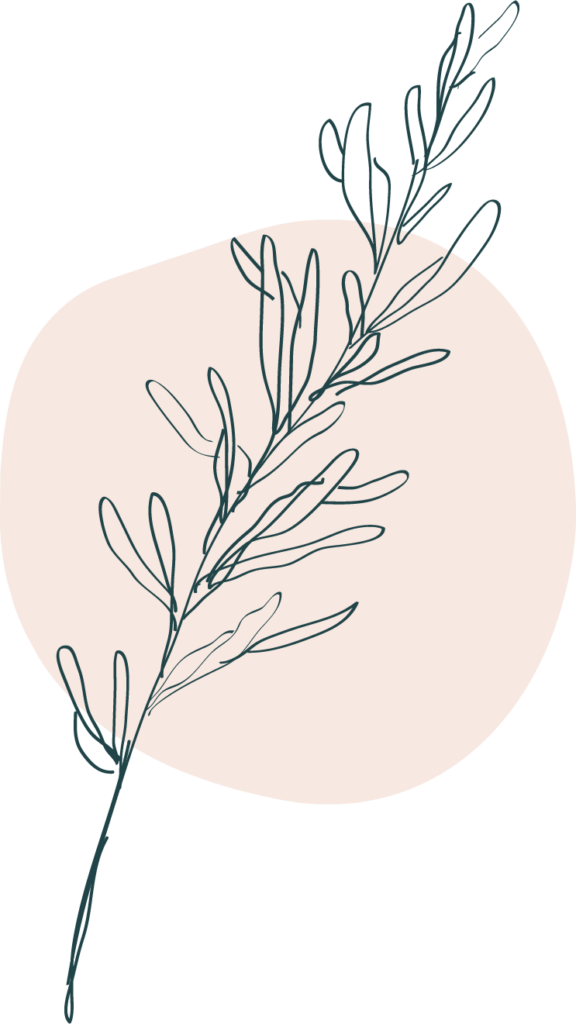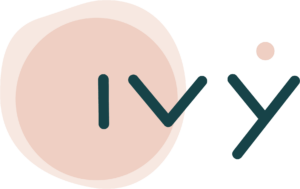Adipositas (Fettleibigkeit) hat sowohl bei Frauen als auch bei Männern einen nachgewiesenen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit und auf den Erfolg einer Kinderwunschbehandlung durch eine Kinderwunschklinik, auf die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft und auf den Schwangerschaftserfolg.
Wir verstehen, dass Paare vielfach sensibel reagieren, wenn sie auf ihr Übergewicht in Zusammenhang mit einer verminderten Fruchtbarkeit angesprochen werden. Nachdem es aber einen wissenschaftlich erwiesenen Zusammenhang zwischen Übergewicht und verminderter Fruchtbarkeit gibt, sehen wir es als unsere Verpflichtung an, Sie auf diesen Faktor hinzuweisen.
Adipöse Frauen sind häufiger von Zyklusabnormalitäten (dreimal öfter), Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten betroffen als Frauen, die normalgewichtig sind. Bei unfruchtbaren, adipösen Frauen kann durch eine Gewichtsreduktion der Erfolg einer Schwangerschaft verbessert werden.
Starkes Übergewicht kann auch in der Schwangerschaft zu Problemen führen. Adipositas ist der Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Schwangerschaftsdiabetes. Das Risiko einer Zuckerkrankheit während der Schwangerschaft ist bei Übergewicht vor der Schwangerschaft (= präkonzeptioneller BMI von 25 bis 30) 2- bis 6-fach höher und bei Fettleibigkeit (= noch höherer BMI-Wert) bis zu 20-fach höher als bei normalgewichtigen Frauen.
Fettleibigkeit erhöht darüber hinaus die Häufigkeit eines schwangerschaftsinduzierten Bluthochdrucks und einer notwendigen Kaiserschnitt-Entbindung. Die durchschnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer nach der Geburt ist in der Folge häufig höher.
Operationskomplikationen (Blutungen, Bildung von Blutgerinnseln in den Gefäßen, Infektionen vor allem des Urogenitaltraktes, Wundheilungsstörungen) bei übergewichtigen Müttern 4- bis 6-mal länger als bei normalgewichtigen Frauen.
Der Anteil der Neugeborenen von stark übergewichtigen Müttern, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, ist 3,5-mal so hoch wie jener von normalgewichtigen Müttern.